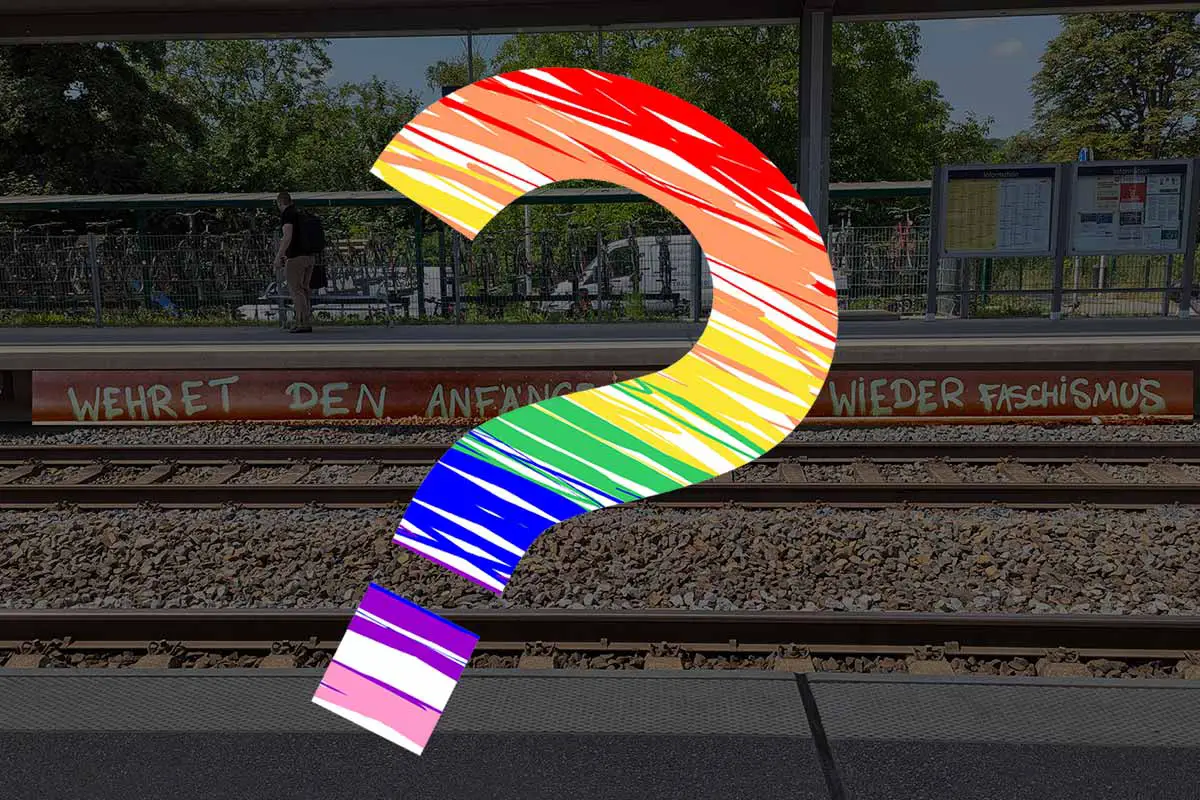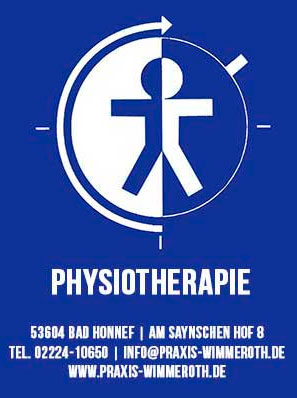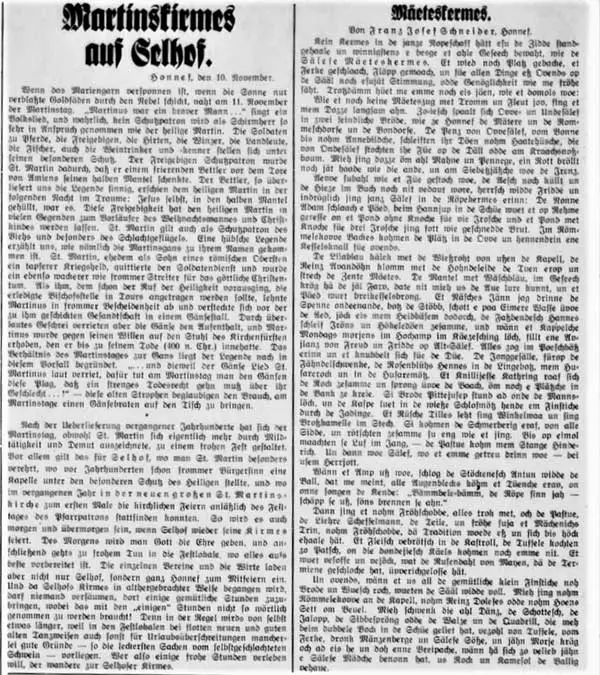Die Entscheidung, AfD-Kandidaten von einer öffentlichen Debatte vor der Bürgermeisterwahl auszuschließen, ist ein zweischneidiges Schwert. Einerseits sendet der Ausschluss ein klares Signal: Demokratische Grundwerte sind nicht verhandelbar. Viele Kritiker sehen in der AfD eine Partei, die mit autoritären, rassistischen oder demokratiefeindlichen Tendenzen spielt – eine Bühne soll ihr deshalb nicht geboten werden.
Andererseits kann genau dieser Ausschluss der AfD nutzen. Wer nicht teilnimmt, muss sich keiner öffentlichen Kritik stellen. Schwächen, Widersprüche oder populistische Vereinfachungen ihrer Kandidaten bleiben im Verborgenen. Eine lebendige Demokratie lebt aber vom Streit der Argumente – gerade mit jenen, die man für gefährlich hält. Politische Auseinandersetzung, die nur unter Gleichgesinnten geführt wird, überzeugt meist nur die ohnehin Überzeugten.
Und noch ein Aspekt: Wenn AfD-Kandidaten mitdiskutieren, müssen sie sich der Realität stellen – etwa konkreten Fragen zur Verwaltung, Finanzen oder sozialen Gerechtigkeit. Häufig zeigt sich dann, wie dünn die Konzepte sind. Das kann entzaubern. Gleichzeitig besteht die Gefahr, dass ein öffentlicher Auftritt rechtsextreme Sympathisanten anzieht und ihnen Raum gibt – nicht nur als Zuschauer, sondern als Stimmungsmacher. Immerhin werden sie so sichtbar. Und man muss beispielsweise nicht länger mühsam recherchieren, welche Bad Honnefer Hobbymannschaft bei einem auswärtigen Turnier den Hitlergruß gezeigt haben soll. Vielleicht stimmt es ja auch (so) nicht.
Die Frage ist also: Was dient der Demokratie mehr – die klare Abgrenzung oder die offene Auseinandersetzung? Vielleicht braucht es beides: eine Bühne, auf der man Populisten stellt – aber auch klare Regeln, was demokratisch sagbar ist.