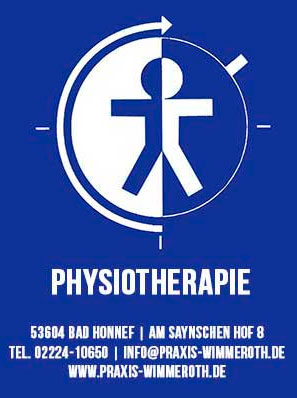Bad Honnef – Mehr als 50 Literaturfreunde kamen am 16. September in die Buchhandlung Werber, um den Werken des jüdischen Autors Michel Bergmann nachzuspüren. Mitglieder des Literaturkreises Siebengebirge (LiS) und des Vereins „Jüdische Vergangenheit und Gegenwart in Bad Honnef“ (JVGH) hatten eine ausführliche Werkschau vorbereitet, die den im Juni verstorbenen Schriftsteller würdigte.
Bergmann, Sohn jüdischer Flüchtlinge, wurde 1945 im Internierungslager Riehen bei Basel geboren. Er arbeitete viele Jahre als Journalist, Regisseur und Drehbuchautor, bevor er mit 65 Jahren seinen ersten Roman „Die Teilacher“ veröffentlichte. Dieses Werk machte ihn schlagartig bekannt. Es folgten mehrere Bücher, darunter die populäre Krimireihe „Der Rabbi und der Kommissar“, deren letzter Band erst vor einer Woche posthum erschien.
Seine Romane sind oft autobiografisch geprägt und schildern das jüdische Leben im Nachkriegsdeutschland. Besonders bemerkenswert ist die sprachliche Lebendigkeit seiner Werke: Immer wieder tauchen jiddische Begriffe auf, die längst Eingang in die deutsche Umgangssprache gefunden haben. In seinem 2023 erschienenen Buch „Mameleben oder das gestohlene Glück“ fügte er sogar ein eigenes Glossar hinzu.
„Mameleben“ gilt als sein persönlichstes Werk. Vordergründig beschreibt es die schwierige Beziehung zwischen Mutter und Sohn, im Kern aber thematisiert es die prägenden Auswirkungen der Kriegserfahrungen der Elterngeneration auf die Nachkriegskinder. Viele Leserinnen und Leser erkennen darin eigene Familiengeschichten wieder.
Eigentlich sollte Bergmann im März 2025 persönlich zu einer Lesung in Bad Honnef erscheinen, doch die Veranstaltung musste krankheitsbedingt abgesagt werden. Am 15. Juni 2025 starb der Autor.
Die Veranstaltung in der Buchhandlung war trotz dieses traurigen Anlasses kein Abend der Trauer. Die humorvolle und zugleich tiefgründige Sprache Bergmanns stand im Mittelpunkt und machte die Lesung zu einer lebendigen Würdigung seines Schaffens. Kurz vor dem jüdischen Neujahrsfest Rosch ha-Schana setzte die Erinnerung an sein Werk ein besonderes Zeichen für Neubeginn und das Weitertragen kultureller Erinnerung.