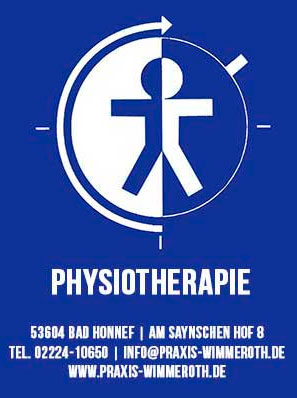Bad Honnef – In Deutschland wird zunehmend Gewalt gegen Kommunalpolitiker verübt – eine alarmierende Entwicklung, die nicht nur die Sicherheit der Betroffenen gefährdet, sondern auch die demokratische Kultur im Land beeinträchtigt. Angriffe, Drohungen und Einschüchterungsversuche sind längst keine Einzelfälle mehr.
Mittlerweile gibt es sogar eine öffentliche Stelle, bei der sich Betroffene Hilfe holen können. Hierbei handelt es sich um ein Gemeinschaftsprojekt der drei kommunalen Spitzenverbände, dem Deutschen Städtetag, dem Deutschen Landkreistag und dem Deutschen Städte- und Gemeindebund, mit der Körber-Stiftung als Projektpartner.
Diese Entwicklung hat gravierende Folgen: Immer weniger Menschen sind bereit, sich kommunalpolitisch zu engagieren, während die Anforderungen an diejenigen, die sich dennoch der Herausforderung stellen, stetig wachsen. Ist das System an seine Grenzen gekommen?
Erschreckende Zahlen und persönliche Schicksale
Laut einer Studie des Deutschen Städtetags sieht sich fast jeder dritte Kommunalpolitiker in Deutschland mit Bedrohungen oder Anfeindungen konfrontiert. Besonders betroffen sind Bürgermeisterinnen und Bürgermeister sowie Ratsmitglieder, die oft im direkten Kontakt mit Bürgerinnen und Bürgern stehen. Die Fälle reichen von Hassmails und Telefonterror bis hin zu Sachbeschädigungen und sogar physischen Angriffen.
Ein bekanntes Beispiel ist Walter Lübcke, der Kasseler Regierungspräsident, der 2019 von einem Rechtsextremisten ermordet wurde. Aber auch jenseits solcher tragischen Extremfälle berichten zahlreiche Kommunalpolitiker über Einschüchterungsversuche und Beleidigungen – insbesondere in sozialen Medien.
Die Folgen: Rückzug aus der Politik
Diese Gewaltspirale hat weitreichende Konsequenzen. Immer mehr Kommunalpolitiker geben ihr Amt entnervt oder verängstigt auf. Gleichzeitig schreckt die zunehmende Aggressivität potenzielle Nachwuchskräfte ab. Wer möchte sich ehrenamtlich engagieren, wenn dies bedeutet, Zielscheibe von Anfeindungen zu werden?
Besonders drastisch zeigt sich diese Entwicklung in ländlichen Regionen, wo es ohnehin oft schwerfällt, Menschen für politische Ehrenämter zu gewinnen. Die Gefahr: Ein Demokratiedefizit, wenn die politische Mitgestaltung vor Ort nur noch von wenigen Personen getragen wird oder sich gar niemand mehr findet.
Wachsende Anforderungen und Überforderung
Neben der Bedrohungslage sehen sich Kommunalpolitiker auch mit immer komplexeren Aufgaben konfrontiert. Sie müssen sich mit einer Vielzahl von Themen befassen – von Stadtplanung über Klimaschutz bis hin zu sozialen Herausforderungen. Gleichzeitig sind die bürokratischen Hürden hoch, und viele Entscheidungen werden durch gesetzliche Vorgaben von Bund und Ländern stark eingeschränkt.
Hinzu kommt, dass viele dieser Ämter ehrenamtlich sind oder nur mit einer geringen Aufwandsentschädigung verbunden sind. Während Bürgermeister oft hauptamtlich tätig sind, engagieren sich Ratsmitglieder und Ortsvorsteher in ihrer Freizeit – neben Beruf und Familie. Die hohe Arbeitsbelastung und die ständige Kritik von allen Seiten führen dazu, dass sich viele überfordert fühlen.
Muss das System reformiert werden?
Angesichts dieser Entwicklungen stellt sich die Frage, ob das kommunalpolitische System in Deutschland reformiert werden muss. Es gibt mehrere mögliche Ansatzpunkte:
Bessere Sicherheitsmaßnahmen
Kommunalpolitiker brauchen besseren Schutz vor Gewalt und Bedrohung. Dies könnte durch verstärkte Polizeipräsenz, konsequentere Strafverfolgung und spezielle Anlaufstellen für betroffene Politiker geschehen.
Mehr Unterstützung und Entlastung
Viele Kommunalpolitiker wünschen sich mehr fachliche Unterstützung, etwa durch professionelle Verwaltungskräfte oder juristischen Beistand. Auch eine bessere Bezahlung für ehrenamtliche Mandate könnte helfen, das Engagement attraktiver zu machen.
Effektivere Bekämpfung von Hassrede
Besonders im digitalen Raum müssen Beleidigungen und Bedrohungen stärker geahndet werden. Plattformen wie Facebook oder X (ehemals Twitter) sollten verpflichtet werden, Hasskommentare schneller zu löschen und Täter zur Rechenschaft zu ziehen.
Stärkung der politischen Bildung
Ein langfristiger Ansatz könnte in einer stärkeren Förderung der politischen Bildung liegen. Wenn Bürgerinnen und Bürger besser über die Aufgaben und Herausforderungen der Kommunalpolitik informiert sind, könnte dies zu einem respektvolleren Umgang beitragen.
Wie sieht die Situation in Bad Honnef aus?
Honnef Heute hat bei den Parteien und im Rathaus nachgefragt, ob sich diese Entwicklung auch dort bemerkbar macht. SPD, CDU, FDP und die Stadt haben geantwortet.
SPD-Fraktionsvorsitzender Guido Leiwig ist Gewalt in seinem Ehrenamt noch nicht begegnet. Allerdings erforderten die zeitlichen und inhaltlichen Anforderungen „tatsächlich ein gewisses Zeitmanagement und eine ständige Befassung mit den Fachthemen“. Für das Amt als ehrenamtlicher Kommunalpolitiker opfert er pro Woche ca. 8 Arbeitsstunden, „abhängig von der Folge der Ausschüsse bzw. Ratssitzungen“.
Elke Buttgereit, CDU-Fraktionsvorsitzende, hat festgestellt, „dass der Ton im Umgang mit Mandatsträgern durchaus rauer geworden ist“. Tätliche Angriffe habe sie „glücklicherweise“ bislang noch nicht erlebt. Die von Thomas de Maiziere vor einigen Tagen angesprochene „Lieferando – Mentalität“ befeuere jedoch auch eine gesteigerte Anspruchshaltung gegenüber ehrenamtlichen Politikern in der CDU-Fraktion der Stadt Bad Honnef. Der langjährige CDU-Bundesminister kritisierte einen respektlosen Umgang von Bürgern mit ihren gewählten Vertretern. Die gesellschaftliche Reputation der Politiker sei so schlecht wie selten.
Der Grund für die mangelnde Akzeptanz der Fakten lieg für Buttgereit „beispielsweise bei den KITA – Beiträgen (die Stadt legt nur max. 10% der Gesamtkosten auf die Eltern um; 90 % zahlt die Allgemeinheit Stadt/Land) oder auch bei dem Ausbau Erzstraße mit der Abrechnung nach KAG – das wird trotz erheblicher individueller Wertsteigerung zugunsten der jeweiligen Grundstückseigentümer schwerlich akzeptiert“. Die Erwartungen vieler Mitbürger würden deutlich von der geforderten Leistungsfähigkeit der Stadt abweichen.
In der CDU-Fraktion werde wiederholt die hohe Komplexität der einzelnen Themen und Herausforderungen diskutiert und der für die Einarbeitung notwendige Zeiteinsatz. Zum Teil müssten mindestens 60-seitige Vorlagen zu den Ausschüssen bearbeitet werden. Neben einer hohen beruflichen Beanspruchung seien diese Anforderungen kaum zu leisten. Auch daher gebe es eine Überrepräsentation von älteren Kommunalpolitikern. Nach den Erfahrungen von Elke Buttgereit liegt der eigentliche zeitliche Einsatz bei einem „einfachen“ Ratsmitglied in der Regel bei mindestens 6 Stunden – je nach Ausschusssitzungen auch deutlich höher. Hinzu kämen noch Einschränkungen bei der zeitlichen Priorisierung, da unter anderem Urlaube und andere Abwesenheiten nicht mit den politischen Aufgaben kollidieren sollten.
Auch der FDP-Fraktionsvorsitzende Carl Sonnenschein hat noch keine extremen Gewalterfahrungen gemacht. Es gebe zwar zum Teil unangenehme Kommentare zur FDP am Wahlstand oder beim Plakatieren, doch hätten diese noch keine strafbare Grenze überschritten, so der Jurist.
Als Angriff auf die Demokratie wertet er die Zerstörung von Wahlplakaten, die am Wochenende in Aegidienberg stattgefunden hat, darunter auch Plakate der FDP.
Sonnenschein: „In meiner hochschulpolitischen Zeit habe ich Erfahrungen gemacht in der Art, dass ich bedroht wurde und versucht wurde mich zu erpressen. Dies kam von links autonomer Seite als sich zu dieser Zeit im Studierendenparlament der Uni Bonn eine Ampel-Koalition abzeichnete. Die autonomen Linken sahen sich von Machtverlust bedroht, indem die Liberale Hochschulgruppe die Autonome Liste in der Regierung (AStA) der Uni Bonn ersetzen sollte. Man rief mich an und teilte mir mit, dass man wisse, wo ich wohne und es nicht zu dieser Koalition kommen sollte.“
Bei der Erledigung der an die Kommunalpolitik gestellten Aufgaben sei eine hundertprozentige Bewältigung der Anforderungen aus seiner Sicht zeitlich wie inhaltlich unmöglich. Bei Bebauungsplänen, weitreichenden Planungen mit finanziellen Auswirkungen oder Verkehrsguachten fehle bei vielen Themen „die idealerweise vorhandene jeweilige Fachkenntnis und auch zum Teil die Zeit, um sich gewissenhaft einzuarbeiten. Man ist in vielen Fällen auf die Vorarbeit der Verwaltung angewiesen und hat nicht immer die Möglichkeit, diese im Zweifel zu hinterfragen“.
Beim Zeitaufwand müsse berücksichtigt werden, „dass viele kommunale Mandatsträger auch noch Posten in Gremien der Partei innehaben, die auch zeitintensiv sein können. Auch liegt es in der Natur der Sache, dass Ratsmitglieder einen höheren Zeitaufwand haben als Fraktionsnmitglieder, die nur einen Ausschuss betreuen“. Weiter sei der Zeitaufwand von den Rats- und Ausschusssitzungen abhängig. Bei einer Woche mit Ratssitzung oder Haupt- und Finanzausschuss könne man mit „etwa zwei Stunden Fraktionssitzung, bis zu vier Stunden Ratssitzung und noch einmal etwa zwei Stunden persönliche Vorbereitung rechnen“. Hinzurechnen müsse man teilweise Abstimmungen mit anderen Fraktionen, die auch eine bis zwei Stunden in Anspruch nehmen könnten. Dies könne sich steigern, wenn andere Ausschusssitzungen dazukämen.
Auch das Leben von Bürgermeister Otto Neuhoff ist nicht vor Respektlosigkeit gefeit. Vereinzelt käme es zu Beleidigungen und verbalen Drohungen, teilt er mit, meist in den sozialen Medien, die sich keinem Spektrum zuordnen ließen. Größten Respekt habe er vor den Bürgerinnen und Bürgern, die sich den Aufgaben der Kommunalpolitik stellen würden, denn wer „sich kommunalpolitisch in Gremien engagiert, muss angesichts der komplexen Aufgabenstellungen grundsätzlich – wenn er es verantwortlich tun will – eine Menge Zeit, Kompetenz und Kritikfähigkeit mitbringen“. Ohne Weiteres sei das für viele nicht zu leisten. Beispiele für sehr hohe Anforderungen seien neben dem Rat der Planungsausschuss, der Betriebsausschuss, der Ausschuss für Umwelt und Verkehr oder auch der Jugendhilfeausschuss. Neuhoff: „Für viele stellt sich aber die Frage, ob Aufwand und Ertrag noch in einem angemessenen Verhältnis stehen, vor allem wenn ein hohes berufliches Engagement oder/und familiäre Aufgaben daneben zu leisten sind.“
Fazit: Die Demokratie schützen
Kommunalpolitiker sind das Rückgrat der Demokratie – sie gestalten direkt vor Ort das Leben der Menschen. Doch die zunehmende Gewalt und die steigenden Anforderungen gefährden dieses Engagement. Wenn sich immer weniger Menschen bereit erklären, sich kommunalpolitisch einzubringen, droht ein massives Demokratiedefizit.
Es ist an der Zeit, dass Politik und Gesellschaft gemeinsam Lösungen finden, um Kommunalpolitiker besser zu schützen, sie zu entlasten und ihnen die Anerkennung entgegenzubringen, die sie verdienen. Denn ohne Menschen, die sich vor Ort engagieren, verliert die Demokratie ihren wichtigsten Baustein: den direkten Austausch zwischen Politik und Bürgern.