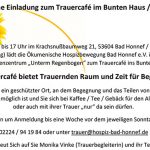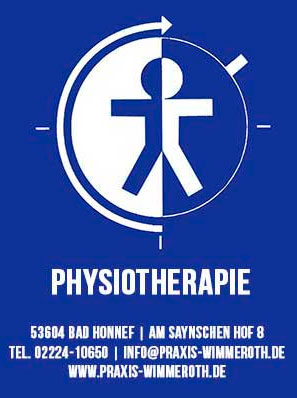Rheinbreitbach – Es war der Abschluss von fünfjährigen Verhandlungen in Münster und Osnabrück, als am 24. Oktober 1648 Vertreter vom römisch-deutschen Kaiser Ferdinand III., dem französischen König Ludwig XIV. und der Königin Christina von Schweden zwei Friedensverträge unterzeichneten. 30 Jahre des Mordens, Folterns und Plünderns sollten hiermit beendet werden. Begonnen hatte dieser Krieg, der die gesamten deutschsprachigen Lande überziehen sollte, mit dem zweiten Prager Fenstersturz 1618. Protestanten (evangelische Christen) hatten dort mit Waffengewalt ihre versprochenen Religionsrechte durchzusetzen versucht, die ihnen einst vom Kaiser des „Heiligen römischen Reiches deutscher Nation“, Rudolf II., versprochen worden waren und nun von seinem Bruder und Nachfolger Matthias schleichend abgeschafft werden sollten.
Der gewaltsame Sturz zweier kaiserlicher Beamter aus einem Fenster der Prager Burg, lösten dabei einen Territorial- und Religionskrieg aus, der sich schon jahrelang angekündigt hatte. Durch Herrschaftsansprüche und Interessen verschiedener Fürstenhäuser, die jeweils katholisch oder protestantisch geprägt waren, entbrannte nun ein Krieg, in denen sich unter anderem Frankreich, Schweden, Österreich, Spanien, Dänemark, Bayern, die Kurpfalz und viele weitere beteiligen sollten. Hierbei kam es zu grausamen Schlachten, Plünderungen und Ausbeutungen. Söldnerheere, die immense Geldsummen und Lebensmittel verschlangen, zogen durch das heutige Deutschland und belasteten vor allem das normale Alltagsleben der Bauern und Bürger. Die Eroberung, Zerstörung und gewaltsame Rekatholisierung Magdeburgs im Mai 1631 durch ein katholisches Söldnerheer unter Tilly und Pappenheim, bei welchem die Stadt dem Erdboden gleich gemacht wurde und die Frauen und Kinder vor den Augen ihrer Männer als „Ehrerniedrigung“ missbraucht und vergewaltigt wurden, stellt nur eines der schlimmsten Ereignisse im dreissigjährigen Krieg dar.

Schreckensmeldungen wie diese gingen allen Söldnerheeren, egal ob katholisch oder protestantisch, voran, wenn diese sich dem eigenen Wohnort näherten. Höhlen wurden zum Eigenschutz gegraben, wertvolle Gegenstände oder Nahrungsmittel in unsichtbaren Nischen oder Aushöhlungen versteckt. Die ärmeren Menschen flüchteten mit dem Vieh (sofern welches vorhanden war) in die Wälder oder abgelegenere Regionen, um sich vor den Söldnern und den Schrecken des Krieges zu verstecken. Auch das zu dieser Zeit katholische Rheinland unter der Herrschaft des Kurfürstentums Köln (in dessen Herrschaftsbereich auch Rheinbreitbach sowie die heutigen Verbandsgemeinden Unkel und Linz lagen) sollte von diesem Schrecken nicht verschont bleiben. 1630 war der protestantische König von Schweden Gustav Adolf II. den deutschen Protestanten gegen den Feldherren Wallenstein (katholische Liga) zur Hilfe geeilt. Sein vorrangiges Ziel war es dabei seinen eigenen Machtanspruch in Pommern und über die Ostsee zu sichern.
Da die deutschen Protestanten jedoch kampfmüde und ablehnend gegenüber den Interessen des Schwedenkönigs waren, schlossen sie sich seinem Feldzug nicht an. Der katholische König Ferdinand ll. sah in dieser Ablehnung die Chance, die gesamten deutschsprachigen Lande wieder zu rekatholisieren. Doch die Meinung der Protestanten sollte sich schlagartig noch ändern. Als nach der Absetzung des Feldherren Wallenstein im Herbst 1630 der Feldherr Tilly die Leitung des katholischen Heeres übernahm, eroberte dieser auf brutalste Weise die Stadt Magdeburg 1631. Der „Schrecken von Magdeburg“ ließ den Kampfgeist der Protestanten wieder aufflammen. Sie schlossen sich dem schwedischen Heer unter Gustav Adolf II. an, um einer völligen Entmachtung und Enteignung zu entgehen.
Der Feldherr Tilly wurde daraufhin empfindlich im September 1631 in Breitenfeld, nördlich bei Leipzig geschlagen. Wallenstein wurde 1632 wieder als Befehlshaber der katholischen Truppen eingesetzt und setzte in der Folgezeit den schwedischen Truppen vor allem bei Nürnberg empfindlich zu. Als Wallenstein den Marsch auf Sachsen im Sommer 1632 plante, stellte sich ihm das protestantische Heer bei Lützen im November 1632 entgegen. Die Protestanten unter Führung des schwedischen Königs gewannen zwar die Schlacht, doch endete der Kampf mit einer Katastrophe. Der schwedische König Gustav Adolf ll. blieb tödlich verwundet auf dem Schlachtfeld zurück.

Doch noch vor seinem Tod bei der Schlacht von Lützen, hatte Gustav Adolf ll. seinem schwedischen General Baudissin den Befehl gegeben, von Frankfurt aus über den Westerwald in Richtung Bonn vorzurücken. Ziel war es die dortigen (überwiegend katholischen) Fürstentümer davon abzuhalten sich der katholischen Liga unter Wallenstein anzuschließen und Lösegeld für die Versorgung des schwedischen Söldnerheeres einzutreiben. Somit rückte Baudissin im Herbst 1632 über Koblenz und den Westerwald in die Stadt Siegburg vor, welche die schwedischen Truppen zu ihrer eigenen Verwunderung im Handstreich nahmen und sich bis 1635 dort festsetzen konnten. Danach besetzten sie den Drachenfels, um die Rheinschifffahrt und damit verbundene Einnahmen kontrollieren zu können. Im Winter 1632 ging dann die Schreckensmeldung in der Stadt Linz ein, dass die Schweden den Marsch auf die Stadt begonnen hätten. Über Sankt Katharinen, wo sie das Kloster der Zisterzienserinnen überfielen und in Brand steckten, näherten sich die Schweden vom Bergrücken aus der Stadt Linz. Linz war zu diesem Zeitpunkt eine gut befestigte Stadt mit hoher Stadtmauer, mehreren Toren, einer ansehnlichen Wehrburg und mehreren Wehrtürmen. Durch die Linzer Eintracht von 1472 gab es zudem ein Bündnissystem zwischen den Städten Unkel, Erpel, Linz, Remagen, Mehlem, Honnef, Königswinter, Oberkassel, Leutesdorf, Bad Hönningen und Niederhammerstein. Das Bündnis sah gegenseitige militärische Hilfe im Angriffsfall vor, der durch den Marsch der Schweden auf Linz nun eintrat. Bei dem Abwehrkampf der Stadt Linz gegen die Schweden halfen daher auf den Linzer Mauern auch Armbrustschützen unter anderem aus dem gegenüberliegenden Ahrweiler. Auch Kämpfer aus den Ortschaften der Verbandsgemeinde Bad Hönningen sowie Unkel dürften hier bei der Verteidigung geholfen haben, auch in dem Bewusstsein, dass man gemeinsam eher noch etwas gegen die Schweden ausrichten könne als allein im eigenen Dorf/Stadt.

Ob Kämpfer aus Honnef oder dem Bereich Königswinter kamen, lässt sich schlecht nachweisen. Eventuell waren die Honnefer sowie die Königswinterer durch die Präsenz der Schweden auf dem Drachenfels sowie auf der Löwenburg bereits hier militärisch gebunden. Wie gut das Bündnissystem zu dieser Zeit noch funktionierte, sei zudem dahingestellt. Es löste sich ohne formellen Beschluss nach dem dreissigjährigen Krieg sang- und klanglos auf.
Trotz Hilfe aus den benachbarten Ortschaften, entschied sich die Stadt Linz sich den Schweden kampflos zu ergeben, um einer kompletten Zerstörung zu entkommen. Nach dem Einmarsch der Schweden in der Stadt Linz nisteten sich die Schweden dauerhaft in der Stadt ein und mussten den Besatzungssoldaten Unterkunft, Nahrung und Lösegeld zahlen. Der ehemalige Bürgermeister Castenholtz wurde vor ein Kriegsgericht gestellt und öffentlich auf dem Marktplatz als Abschreckung hingerichtet, da er angeblich Bad Hönningen vor den herannahenden Schweden gewarnt hatte. Von Linz dort aus operierten die Schweden im ganzen Rheingebiet bis nach Neuwied sowie auf der anderen Rheinseite in Remagen und bis nach Andernach. Sie nahmen Bürger als Geisel, forderten hohe Lösegelder von Kurköln und terrorisierten die Region. Die Insel Nonnenwerth nahmen sie in Besitz und nutzten die dortige katholische Kirche als Pferdestall (wohl auch, um ihrer Verachtung für den katholischen Glauben Ausdruck zu geben)

Andernach traf es besonders schwer, als die dortigen Bürger nicht direkt die Forderungen der Schweden erfüllten, sodass die Stadt geplündert wurde. Auf das Gebiet der Verbandsgemeinde Unkel rückten die Schweden im Jahre 1633 vor. Zuerst plünderten die Schweden ohne große Gegenwehr das gut befestigte Erpel (Stadtmauer und Tore) bevor sie dann auf die Stadt Unkel zumarschierten. Die Einwohner der Stadt Unkel waren verteidigungstechnisch sogar noch besser aufgestellt als die Erpeler. Unkel hatte eine feste hohe Stadtmauer mit mehreren Toren und einem Wallgraben. Reste dieser gewaltigen Anlage sind heute am Rhein mit dem Gefängnisturm sowie am katholischen Pfarrhaus zu sehen. Als die Schweden in Unkel einrücken wollten, wehrten diese sich wohl nicht sonderlich viel. Vorab hatten die Schweden den Unkelern wohl gedroht die Stadt komplett zu zerstören, wenn sie sich nicht ergeben und einen geforderten Tribut in Form von Lebensmitteln oder Geld zahlen würden. Die Angst, das Unkel ein Schicksal wie die Einwohner von Andernach, Linz oder gar Magdeburg ereilt, spielte hier eventuell eine Rolle, sodass die Unkeler den Forderungen der Schweden nachgaben. Dies bewahrte die Unkeler jedoch nicht vor Verwüstungen und Plünderungen. Der Unkeler Schultheiß Johann Adam Herrestorff bat deshalb die Obrigkeit des Fronherr, des Stiftes St. Maria ad Gradus zu Köln, um Steuer- und Pachtnachlass. Er schrieb, dass Häuser, Ställe und Scheunen teils abgebrannt und ruiniert seien. Alles, wovon man leben sollte, sei geplündert und geraubt worden. Aus Köln kam auf diese Bitte keine Antwort, was die Unkeler wohl als stille Zustimmung deuteten und keinen Fron zahlten, Die vom Unkeler Schultheißen erwähnten Zerstörungen lassen sich auf einer Federzeichnung aus dem Jahr 1637 von Wenzel Hollar nicht nachvollziehen. Das bedeutet aber nicht, dass diese nicht existiert haben. Zerstörte Fachwerkhäuser lassen sich beispielsweise zügig wieder errichten. Zudem haben die Schweden Unkel wohl von der südlichen Richtung aus Unkel angegriffen, die auf der Zeichnung nicht gut zu erkennen ist. Was auf jeden Fall blieb, sind die psychischen Schäden der Unkeler Bürger sowie der Verlust an Lebensmitteln, welcher in dieser Zeit für die Bewohner lebensbedrohlich war.
Nachdem Unkel die Forderungen der Schweden erfüllt hatte, ging die Nachricht vom Einmarsch der Schweden in Erpel und Unkel natürlich wie ein Lauffeuer in die umliegenden kleinen Ortschaften Scheuren, Bruchhausen, Orsberg und (Rhein-)Breitbach herum. Ängste und Panik machten sich breit. Manch einer dürfte die wenigen Habseligkeiten sowie die eigene Familie gepackt und damit in die nahen Wälder geflüchtet sein, um sich dort zu verstecken. Andere wiederum dürften überlegt haben, wie der Schaden am Dorf so gering wie möglich gehalten werden könnte oder ob man sich nicht doch den Schweden militärisch entgegen stellen sollte.
Doch die kampferprobten schwedischen Söldner, bewaffnet mit Schwertern, langen Spießen (sog. Partisanen), Harnischen, Musketen und vereinzelt mit kleineren Geschützen zogen letztlich ohne große Gegenwehr durch die kleinen Ortschaften. Viel entgegenzusetzen hatten die kleinen Dörfchen auch nicht. Breitbach beispielsweise hatte wie viele andere Ortschaften im Kreis Neuwied auch, nur noch einen ungepflegten Palisadenwall aus dem Mittelalter. Dieser bestand aus einem tiefen Graben und einem Gebück. Das Gebück war hierbei ein dorniger Busch, der für Angreifer undurchdringlich gewesen war. Doch einem längeren Angriff konnte diese Verteidigungsanlage nicht standhalten. Die Untere Burg sowie die festen Häuser in Breitbach, die aus Stein gebaut waren, hätten zwar länger durchhalten können, aber auch hier wäre die Sinnhaftigkeit dieses Vorhabens doch fragwürdig gewesen, da die Schweden zahlenmäßig überlegen waren. Zudem verfügten die Breitbacher im besten Falle nur über ein paar Spieße und Armbrüste sowie Mistgabeln. Eine Übergabe des Dorfes sowie die Hoffnung, dass die Schweden schnell gegen Zahlung und Erfüllung der Forderungen durch den Ort ziehen würden, war daher realistisch. Wer aus Breitbach kämpfen wollte, hatte dies bereits in den besser befestigten Städten in Unkel oder Linz getan.
Die Schweden requirierten daher in Breitbach und den umliegenden Ortschaften alles nach Kriegsbrauch an Nahrungsmitteln und Wertgegenständen, um sich selbst zu versorgen und die Söldner bei Laune zu halten. Der rheinische Wein (besonders aus Erpel) war hierbei ein besonderes Diebesgut, da die Söldner sich im Suff ein schönes Leben zwischen den Schlachten und Kämpfen machen wollten. Letztlich lebten sie in der Gewissheit, dass jeder Tag ihr letzter Tag sein könnte. Verwüstungen im Ort sowie das ein oder andere Saufgelage mit Missbrauch der Dorfbewohnerinnen wird es schon gegeben haben.

Ob bei dem Durchmarsch die katholische Kirche letztlich angezündet wurde, bleibt hier fragwürdig. Zerstörungen gab es in der Kirche bestimmt. Letztlich erfüllten die Breitbacher alle Forderungen. Dennoch blieben Verwüstungen nicht aus. Felder, Rebstöcke und Wiesen wurden wie überall angezündet oder unbrauchbar gemacht. All dies hatte schwere Folgen nicht nur für die Bewohner von Breitbach, sondern für die ganze Region.
Das kleine Örtchen Berg beispielsweise, einst zwischen Scheuren und Rheinbreitbach gelegen, ist nach dem dreißigjährigen Krieg nicht mehr nachweisbar. Es erlitt vermutlich wie viele Ortschaften das Schicksal einer vollständigen Vernichtung und Entvölkerung. Lebensmittelknappheit und Hunger breiteten sich aus. Ein Bittbrief nach dem anderen traf daher beim katholischen Kurfürsten in Köln Ferdinand von Bayern ein, um in der Situation Abhilfe zu schaffen.

Um das katholische Rheinland sowie das Mittelrheintal nicht an die Schweden dauerhaft zu verlieren, rüstete der Kurfürst ein Söldnerheer bestehend aus Spaniern, kurkölnischen Soldaten und Luxemburgern aus, um die Schweden zu vertreiben. Mit Hilfe des Grafen Ernst von Isenburg Grenzau (damaliger Besitzer Schloß Arenfels in Bad Hönningen) und seiner Armee wurden die Schweden an verschiedenen Stellen (vor allem linksrheinisch) zurückgedrängt. Bei dem Versuch die Schweden aus Andernach zu vertreiben, musste er sich jedoch auf die rechte Rheinseite zurückziehen, da ein schwedisches Entsatzheer den Verteidigern zur Hilfe kam. 1633 wurde der Drachenfels sowie weitere rechtsrheinische Burgen wieder zurückerobert. Als Folge hiervon wurde 1634 der Drachenfels geschleift. Die Ende 1632 von den Schweden eroberte Burg Hammerstein hingegen blieb vorerst schwedisch besetzt bevor sie dann wieder von den katholischen Spaniern zurückerobert wurde. Bis spätestens Ende 1633 vertrieben jedoch die kurkölnischen Truppen die Schweden wieder von den rechtsrheinischen Ortschaften, die zu Kurköln gehörten.
Doch es dauerte noch Jahre bis die Kriegsfolgen in der Region überwunden waren. Zerstörte Felder, gestohlenes Vieh sowie Missernten und Krankheiten (Pest) setzten den Menschen in den folgenden Jahren zu und der Dreißigjährige Krieg war 1635 keineswegs vorüber. Eigentlich hatten die deutschen Kriegsparteien mit dem Frieden von Prag ihre Kampfhandlungen eingestellt. Doch Frankreich unter Ludwig XIII. und seinem Kanzler Richelieu sahen es mit Sorge, dass die Macht der Habsburger in Europa durch einen Friedensschluss mit den Schweden gefestigt und ausgebaut wurde. Somit zogen die katholischen Franzosen gegen Spanien und den Habsburger Kaiser in den Krieg, um den protestantischen Schweden beizustehen und die Macht der Habsburger zu beschneiden. Der Krieg hatte sich von einem religiösen Kampf zu einem reinen Machtkampf gewandelt.
Als die Nachricht von dem Friedensschluss 1648 aus Münster kam, ging daher ein Seufzer der Erleichterung durchs Land, verbunden mit der Hoffnung in Zukunft in Frieden leben zu können.
Ein besonderer Dank bei der Erstellung gilt dem Unkeler Stadtarchivar Wilfried Meitzner, der bei der Korrektur des Textes geholfen hat.
Quellen- und Literaturverzeichnis:
Bedürftig, Friedemann: Taschenlexikon Dreißigjähriger Krieg. München 2002.
Brungs, Joseph u.a.: Chronik Rheinbreitbach. Rheinbreitbach 1929.
Kemp, Franz Hermann: „Aus der Geschichte Unkels“. In: Heimatkalender des Kreises Neuwied 1952, Kreisverwaltung Neuwied (Hrsg.), Neuwied 1952, S. 77ff.
Meitzner, Wilfried: „Unkel in alten Ansichten“. In: Reihe Unkeler Geschichtsboten Nr. 23, Geschichtsverein Unkel, Unkel 2014, S. 6 f.
Müller, Dr Dr Carl : Schwedische Soldaten am Mittelrhein und im Ahrtal von 1632 bis 1635. In: https://relaunch.kreis-ahrweiler.de/kvar/VT/hjb1962/hjb1962.49.htm (abgerufen am 14.08.2023, Uhrzeit 15:00 Uhr)




![16.08. | De Knippschaff kommt nach Rhöndorf 11 [object Object]](https://honnef-heute.de/wp-content/uploads/2024/06/AntoniterKnipp-web-150x150.jpg)