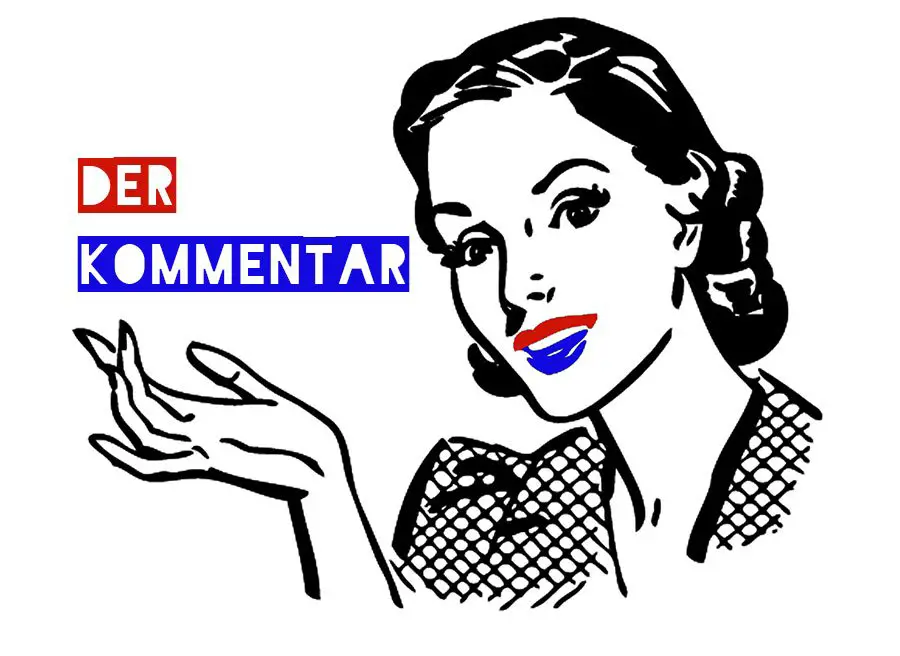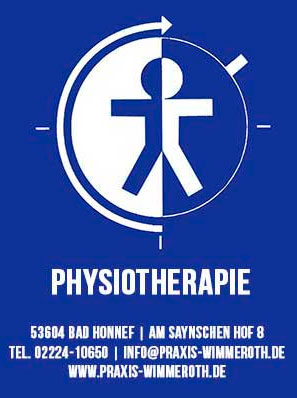Mit dem Tod von Papst Franziskus ist eine Ära zu Ende gegangen. Eine Ära, in der die katholische Kirche zaghaft versuchte, sich dem 21. Jahrhundert anzunähern – und doch in vielen Punkten hinter ihren eigenen Ansprüchen zurückblieb. Nun, inmitten der tiefen Trauer und Neuorientierung, stellt sich eine Frage mit neuer Dringlichkeit: Ist es nicht endlich an der Zeit für eine Päpstin?
Eine Institution im Wandel – oder doch nicht?
Papst Franziskus war für viele Gläubige ein Hoffnungsträger. Mit seiner offenen Art, dem Einsatz für soziale Gerechtigkeit und der Betonung von Barmherzigkeit statt Dogmatismus hat er Millionen berührt. Doch seine Pontifikatsjahre waren auch geprägt von Halbherzigkeit, wenn es um die Stellung der Frau in der Kirche ging. Immer wieder betonte Franziskus die „komplementäre“ Rolle der Frau – ein Begriff, der sich in der Praxis oft als Synonym für „zweitrangig“ herausstellt.
Frauen haben heute in der katholischen Kirche keine Möglichkeit, geweiht zu werden – weder als Priesterinnen noch als Diakoninnen. Der Papst selbst ließ zwar Studienkommissionen einsetzen, die sich mit dem historischen Diakonat der Frau befassten, doch konkrete Reformen blieben aus. Auch der Zugang zu leitenden Positionen in der Kurie ist für Frauen nur eingeschränkt möglich. Die Glaskuppel des Vatikans bleibt undurchlässig – es sei denn, man trägt Soutane.
Warum jetzt?
Der Tod eines Papstes ist immer auch ein Moment der Reflexion, der Neuordnung, ein kurzer historischer Spalt, durch den frische Luft strömen könnte – wenn man es zulässt. Das Konklave, das nun zusammenkommen wird, bietet die seltene Gelegenheit, alte Strukturen zu hinterfragen. Warum also nicht das Undenkbare denken? Warum nicht einen Schritt wagen, der nicht nur symbolisch, sondern strukturell revolutionär wäre?
Eine Päpstin wäre nicht bloß eine Antwort auf den Zeitgeist, sondern eine Rückbesinnung auf die eigentlichen Werte des Christentums: Gerechtigkeit, Würde, Gleichwertigkeit. Sie wäre ein Signal an die Hälfte der Menschheit, die seit Jahrhunderten im Namen Gottes systematisch marginalisiert wird. Und sie wäre eine Hoffnungsträgerin für die zahllosen Frauen, die in der Seelsorge, in der Theologie und in der Basisarbeit längst das Rückgrat der Kirche bilden – ohne je Teil ihrer höchsten Führung sein zu dürfen.
Das Argument der Tradition – ein Vorwand?
Gegner dieser Idee verweisen gerne auf die kirchliche Tradition, die eine Päpstin ausschließt. Doch Tradition ist kein starres Monument. Sie lebt, verändert sich, wächst. Auch die Wahl eines nicht-italienischen Papstes war einst undenkbar. Auch die Messe in der Landessprache war einst ein Tabubruch. Die Kirche hat sich immer dann erneuert, wenn sie den Mut fand, das scheinbar Unverrückbare neu zu denken.
Und: Die Vorstellung, dass Frauen niemals Führungsrollen in der frühen Kirche innehatten, ist historisch keineswegs eindeutig belegt. Es gibt Hinweise auf Diakoninnen, Apostelinnen und Gemeindeleiterinnen in der Urkirche. Die Legende der Päpstin Johanna – ob wahr oder nicht – zeigt zumindest, dass diese Idee eine jahrhundertealte kulturelle Resonanz besitzt.
Die Kirche steht am Scheideweg
Die katholische Kirche verliert weltweit an Einfluss, an Gläubigen, an Relevanz. Besonders in Europa und Nordamerika wenden sich viele – vor allem junge Menschen – enttäuscht ab. Eine Kirche, die Frauen weiterhin systematisch ausschließt, wird in Zukunft kaum noch überzeugen können. Eine Kirche, die sich hingegen für Gleichberechtigung öffnet, könnte neue Glaubwürdigkeit gewinnen – und echte Erneuerung erfahren.
Ein mutiger Schritt – aber nicht unmöglich
Natürlich, eine Päpstin bräuchte weitreichende strukturelle Reformen: die Öffnung des Weiheamts für Frauen, eine Neudefinition des Priesterbildes, möglicherweise sogar ein neues Konzil. Doch Reform beginnt immer mit einer Idee, mit einer Vision, mit einer mutigen Entscheidung.
Der Moment ist gekommen, diese Vision ernst zu nehmen.
Denn wenn nicht jetzt – wann dann?