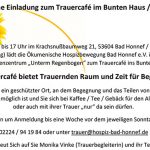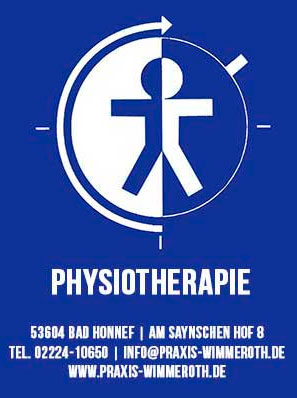Bad Honnef – Es war das erste Mal, dass ich an einer UNO-Klimakonferenz teilnahm. Als Umweltjurist und Menschenrechts-Aktivist, der seit mehreren Jahren in Ägypten lebt, konnte ich mir die Chance nicht entgehen lassen, vor Ort in Sharm mitzuwirken. Allerdings kann natürlich nicht jeder dort ohne weiteres „mitmischen“: Man muss bei der UNO akkreditiert sein, entweder für Woche 1 oder Woche 2 (oder für beide). Eine „Blaue Zone“ ist ausschließlich für politische Delegationen, NGOs, oder zwischenstaatliche Organisationen reserviert. Die sogenannte „Grüne Zone“ ist wesentlich offener zugänglich, da sie für Zivilgesellschaften geschaffen ist, und man sich somit leicht persönlich registrieren kann.
In Woche 1 repräsentierte ich eine französisch-kamerunische NGO, Carré Géo et Environnement, und in Woche 2 die englische NGO Canterbury Climate Action Partnership (CCAP). Während sich Carré Géo vor allen Dingen mit dem Thema Klimamigration befasst, geht es CCAP hauptsächlich darum, wie sich in Zukunft Städte und urbane Zentren besser an den Klimawandel anpassen können. Mit meinem beruflichen und universitären Hintergrund in Völkerrecht fühlte ich mich hier folglich gut aufgehoben.
Woche 1: World Leaders Summit & viele Wo-Bin-Ich-Momente
Meine erste Woche bei COP27 war intensiv und oft überwältigend. Ich brauchte gefühlte drei Tage, um mich überhaupt erst einmal zurecht zu finden. Das gesamte Gelände der Klimakonferenz glich einem Labyrinth. Es war eine Mischung aus Messe und Tagungszentrum, das mich mit seinem Gewimmel und Lautstärke-Pegel an die Dubai-Expo erinnerte. Etliche aneinandergereihte Container wurden mir zu einem wahren Irrgarten. Durch oft irreführende Wegweiser fehlgeleitet, raste ich teilweise eine knappe halbe Stunde von einem Event zum anderen.
Dieses Jahr fanden neben den offiziellen Verhandlungen und Treffen der einzelnen Länder auch Nebenveranstaltungen statt, organisiert sowohl von den Vereinten Nationen selbst sowie von Ländern und IGOs, wie z.B. der EU und der African Union, die alle mit Pavillons hier vertreten waren. Da fast jeder Pavillon zeitgleiche Events anbot, musste ich mir erstmal einen guten Überblick verschaffen, Prioritäten setzen und einen genauen Zeitplan für die maßgeblichen Veranstaltungen kreieren.

Trotz dieser sinnesüberwältigenden, oft chaotischen ersten Eindrücke gab mir das Szenario Hoffnung: Es bewegt sich etwas. Jedes Jahr wächst die COP-Konferenz, der grüne Jobsektor floriert; Klimawandel ist nicht mehr nur für „Ökos“ reserviert, sondern wird Mainstream. Dass das natürlich auch daran liegt, dass sich der Klimawandel immer deutlicher bemerkbar macht, ist die Kehrseite. Kein Land der Erde kann mehr behaupten, nicht von ihm betroffen zu sein. Selbst in Deutschland bemerken wir die immer heißer werdenden Sommertage, den ausfallenden Regen und die Extremereignisse.
Die ersten zwei Tage der Klimakonferenz waren dem Gipfeltreffen von Staats- und Regierungschefs gewidmet. Unter den rund 100 anreisenden Staats- und Regierungschefs war neben Bundeskanzler Olaf Scholz und US-Präsident Joe Biden auch der neue britische Premierminister Rishi Sunak. Es war faszinierend, mit all diesen Staatslenkern im selben Raum zu sitzen. Während Staatsoberhäupter der verletzlichsten Staaten, der Small Island Developing States (SIDS), wie z.B. Barbados z.T. vehement betonten, sie hätten durch den Klimawandel bereits tagtäglich verheerende Folgen auszustehen (wofür eben die Industriestaaten mit ihren Emissionen grade zu stehen hätten) glichen die Reden der G7-Mächte oft mehr aneinander gereihten Floskeln. Ja, man müsse mehr tun. Kaum jemand machte jedoch konkrete Vorschläge oder Aktionen oder nannte fassbare Gelder, die fließen könnten.
Immerhin sagte Bundeskanzler Scholz den am ärgsten durch klimabedingte Schäden betroffenen Entwicklungsländern 170 Millionen Euro zu. Demnach wolle Deutschland diese „vom Klimawandel am schwersten betroffenen Länder gezielt im Umgang mit Verlusten und Schäden unterstützen“, so Scholz im Plenarsaal.

Im Zentrum: Schaffung eines Verlust- und Schadensfonds
Scholz stimmte damit auf das Hauptaugenmerk der Konferenz ein: der Schaffung eines Entschädigungsfonds für klimabedingte Schäden („loss and damage“). Da vorwiegend Entwicklungsländer diesen Schäden ausgesetzt sind, obwohl diese am Wenigsten zur Entstehung dieser Schäden beitragen, sollen Industrieländer diesen Fond finanziell tragen.
Der Klimagipfel musste um zwei Tage überzogen werden, um schließlich zu einem Ergebnis zu kommen: der Fonds ist da. Symbolisch gesehen ist dies seit dem Pariser Abkommen 2015 ein historisches Ergebnis. Auf diesen Fonds hatten viele Nationen bereits seit Beginn der Klimagipfel rund 30 Jahre lang warten müssen. Wohlhabende Länder hatten die Idee eines solchen Fonds lange blockiert. Endlich eine Einigung über die Schaffung eines solchen Fonds zu erzielen, ist ein Meilenstein. Allerdings nur, weil die entsprechende Regelung auf freiwilliger Basis und ohne Anerkennung einer Rechtspflicht umgesetzt werden soll.
Es geht nämlich um gewaltige Summen, die gezahlt werden, wenn Überschwemmungen oder Wirbelstürme über Länder hinwegfegen oder wenn Hitzewellen und Trockenheit Hungersnöte hervorrufen. Auch Klimafolgen wie der Meeresspiegel-Anstieg könnten zu Zahlungen führen.
Schaut man sich den Text jedoch näher an, ist man enttäuscht. Es findet kaum Erwähnung, wie dieser Fonds in Wirklichkeit operieren soll. Welche Länder werden wie viel einzahlen? Unter welchen Konditionen wird ausgezahlt und an wen? Die genauen Details sollen 2023 beim nächsten Klimagipfel in Dubai in den Vereinigten Arabischen Emiraten festgeklopft werden.
Offen bleibt jetzt auch, ob nur Industrieländer oder auch potente Schwellenländer wie China in den Fonds einzahlen sollen. Die Vereinigten Staaten wie auch die Europäische Union drängen auf Chinas Zusicherung, letztendlich auch zu diesem Fonds beizutragen – geschweige denn, dass China berechtigt sei, Geld aus diesem Topf zu erhalten. Denn die Vereinten Nationen stufen China derzeit noch als Entwicklungsland ein, wodurch es Anspruch auf Klimakompensationen hätte, obwohl es momentan als weltgrößte Volkswirtschaft auch der weltweit größte Emittent von Treibhausgasen ist. China wehrt sich jedoch heftig, in den globalen Klimaverhandlungen auf eine Stufe mit den Industriestaaten gestellt zu werden.
Trotz all dieser Ungewissheiten kann man davon ausgehen, dass es bei der Schaffung dieses Verlust- und Schadensfonds zunächst einmal darum geht, Vertrauen aufzubauen und Einigkeit zu fördern, als Geld, Entschädigungen oder Wiedergutmachungen bereitzustellen. Der Fonds zeigt, dass trotz der enormen Auswirkungen der globalen Erwärmung niemand zurückgelassen werden soll.
Zyniker unter uns können natürlich fragen, ob Vertrauen und Einigkeit Inseln vor dem Versinken bewahren können. Denn egal wie viel Geld in den Fonds fließt – bei einer Erderwärmung um 3 °C gegenüber dem vorindustriellen Wert würde ein Fonds nun wirklich nicht mehr viel nützen. Auf Grund klimabedingter Dürren und Missernten würde auch nicht mehr genügend Getreide auf dem Weltmarkt angeboten werden.
Und was ist mit den 1,5 Grad?
Während der Fonds das Aushängeschild des Klimagipfel ist, schämt man sich für die fehlende Substanz in Sachen 1,5 Grad. Der schlussendliche Resolutionstext enthält keinerlei Hinweise auf einen Ausstieg aus fossilen Brennstoffen – trotz aller Kritik aus EU und anderer Industrieländer; denn dies wäre ein wichtiger Grundbaustein für einen wahren Fortschritt seit den Klimaverhandlungen in Glasgow 2021 gewesen.
Die Ziele des Pariser Klimaschutzabkommens wurden lediglich bestätigt, die Begrenzung der Erderwärmung auf 1,5 Grad verglichen mit dem vorindustriellen Niveau in Reichweite zu halten. Bis 2030 – folglich innerhalb von 8 Jahren – müssten dafür allerdings die klimaschädlichen Emissionen fast halbiert werden im Vergleich zum Stand von 2019. Gemäß der momentan national festgelegten Beiträge (NDCs) werden die globalen Temperaturen allerdings immer noch um weit über 2,0 °C steigen (selbst wenn man davon ausgeht, dass alle jetzigen NDC-Verpflichtungen erfüllt werden). Die NDCs müssen also bis Ende 2023 aktualisiert werden, um sie dem Temperaturziel des Pariser Abkommens anzupassen. Genau dies geschah in Scharm el-Scheich eben nicht. Der Vorschlag, die Emissionsspitze bis 2025 zu erreichen, wurde abgelehnt. Der Gesamttext stellt somit eine verpasste Chance im Kampf um die 1,5 Grad-Marke dar.
Der Text erwähnt allerdings „emissionsarme und erneuerbare Energien.“ Da Erdgas weniger Emissionen verursacht als Kohle, wird dies als erhebliches Schlupfloch angesehen, was die Erschließung weiterer Gasressourcen ermöglichen könnte. Während Industrienationen wie Deutschland sich von fossilen Brennstoffen so schnell wie möglich verabschieden wollen, kontern Schwellenländer wie z.B. Indien, dass sie ihre Ressourcen genauso ausnutzen möchten wie es die Industrienationen all die Jahrzehnte zuvor getan hätten.
Vielleicht wurde der endgültige Text von der überwältigenden Zahl Besucher aus dem Öl- und Gassektor auf der COP27 entscheidend beeinflusst: 636 Öl- und Erdgas-Lobbyisten verliehen einigen Pavillons zeitweise den Eindruck einer Messe für fossile Brennstoffe.
Fokus der Nebenveranstaltungen: Klimagerechtigkeit & Menschenrechte
Neben den offiziellen Verhandlungen nahm ich an zahlreichen Nebenveranstaltungen teil. Besonders der deutsche Pavillon beeindruckte mich mit seinem Menschenrechts-Fokus „Ambition through Solidarity“, also „Ehrgeiz durch Solidarität“. Damit zielte man vor allen Dingen auf die Menschenrechtssituation des Gastgeberlandes Ägypten ab.
Klimawandel, Umweltverschmutzung und Biodiversitätsverlust bedrohen zunehmend auch Menschenrechte, insbesondere benachteiligter Bevölkerungsgruppen im globalen Süden. Eine hochrangige Veranstaltung des Auswärtigen Amtes rund um Klimawandel und Menschenrechte machte dabei deutlich, dass eine starke Zivilgesellschaft entscheidend ist, um ambitionierte Klimaziele einzufordern. Referenten aus verschiedenen Interessengruppen führten einen Dialog über die vielfältigen Zusammenhänge zwischen Klima und Menschenrechten und boten Perspektiven für mögliche Lösungen.
Unter ihnen war Außenministerin Annalena Baerbock. Sie betonte, dass Klimawandel und Menschenrechte Hand in Hand gingen. Sich gegen den Klimawandel einzusetzen heiße, für Menschenrechte zu kämpfen. Als die Fluten in Pakistan diesen Sommer Millionen Menschen obdachlos machten, verloren unzählige Menschen ihre Lebensgrundlage, ihre Rechte auf Gesundheitsversorgung und Bildung. Baerbock begrüßte daher eine aktive Zivilgesellschaft, ohne die viele der jetzigen Debatten auf dem Klimagipfel andernfalls so nicht auf dem Tisch lägen.
Vanuatus Klimaminister, Ralph Regenvanu, wies darauf hin, dass der pazifische Inselstaat bereits heute für Verluste und Schäden aufkommen müsse, da Kinder nicht mehr zur Schule gingen, weil ihre Schulen oder Schulwege weggespült seien und dem Land die notwendigen Mittel fehlten, um sie wiederaufzubauen. Während Vanuatu bislang 100 Millionen Dollar an Klimafinanzierung erhielt, richtete ein Zyklon kürzlich 600 Millionen Dollar Zerstörung an.
Human Rights Watch Umweltdirektor Richard Pearshouse fügte hinzu, seine ägyptischen Kollegen könnten an dieser Veranstaltung nicht teilnehmen, da ihnen Strafverfolgung und möglicherweise Gefängnis drohten. Er sprach darüber, wie die ägyptische Zivilgesellschaft aktiv in ihrem Tun gebremst werde, seitdem das Militär große Teile des Landes kontrolliere. Jegliche Umweltkritik an großen Infrastruktur-Projekten würde schnell unterdrückt, während der Öl- und Gassektor expandierte.
In einem weiteren deutschen Event ging es um die Anprangerung politisch inhaftierter Ägypter. Unter ihnen Alaa Abd El-Fattah, ein prominenter ägyptisch-britischer Regierungskritiker, Menschenrechtler und Blogger, der seit 3 Jahren wegen Verbreitung von „Fake News“ im Gefängnis sitzt. Die deutsche Delegation lud seine Schwester, Sanaa Seif, neben der Generalsekretärin von Amnesty International, Agnès Callamard, und Executive Director von Human Rights Watch, Tirana Hassan, zu einem kritischen Gespräch ein. Im Vorfeld der COP27 waren Berichten zufolge etwa 100 Menschen bereits „vorsorglich“ festgenommen worden. Ihnen wird unter anderem die Verbreitung von Falschnachrichten vorgeworfen. Proteste von Klimaschutzaktivisten waren während der Klimakonferenz lediglich in einer speziell dafür eingerichteten Zone erlaubt.
Im Gespräch wurde deutlich, wie wichtig der Schutz von Menschenrechten für die Verwirklichung von Klimagerechtigkeit („Climate Justice“) sei. Dazu gehöre, sicherzustellen, dass alle Klimarichtlinien ehrgeizig genug seien, um die Menschenrechte der am stärksten von der Klimakrise Betroffenen angemessen zu schützen. Es bedeute auch, dass sowohl Klimaaktivisten wie auch die Zivilgesellschaft insgesamt ihre Meinung frei äußern und auf die Straße gehen könnten, um ehrgeizige Klimaschutzmaßnahmen zu fordern und Korruption aufzudecken wie auch diejenigen, die unsere Umwelt gefährdeten. Sanaa Seif las ein bewegendes Plädoyer ihres Bruders Alaas vor, in dem deutlich wurde, wie sehr er sich für die Freiheit der Zivilgesellschaft seines Landes einsetzte und wie wichtig es sei, eine starke Zivilgesellschaft zu haben, die ihre Regierung zur Rechenschafft zieht.
Auch in anderen Pavillons tauchte das Thema „Klimagerechtigkeit“ immer wieder auf. Gerade im Hinblick auf den globalen Süden wurde immer wieder deutlich, wie stark Klimapolitik „dekolonialisiert“ werden müsse; denn Klimapolitik war bislang immer Machtpolitik. Anstatt mit einer westlichen, besserwisserischen Perspektive vorzugeben, wie man sich am besten an den Klimawandel anpassen oder ihn bekämpfen müsse, solle man im Globalen Süden direkt nachfragen. Es gäbe dort lokale Lösungen, die man gezielt anwenden könne. Oft würden diese automatisch übersehen.
Kanada überraschte ebenfalls mit einem Event rund um LGBTQ+-Rechte & Klimaschutz: Diskussionsteilnehmer tauschten gelebte Erfahrungen mit Klimaschutzmaßnahmen in Kanada aus und teilten ihre Perspektiven zur Bedeutung praktischer Schritte zur Einbeziehung von LGBTQ+-Personen zur Bewältigung der Klimakrise. Queere Ideologien als Herausforderung der Normativität besäßen sehr wohl das Potenzial, wirkungsvolle Klimalösungen hervorzubringen.
Einige Diskussionsteilnehmer zeigten in diesem Zusammenhang einen Film über LGBTQ+-Vorbilder, die die Welt veränderten, von Kunst über Wirtschaft bis hin zur Politik. Das Panel war ein leidenschaftliches Plädoyer dafür, warum queere Führungspersönlichkeiten an jedem Entscheidungstisch beteiligt sein sollten. „Als queere Menschen denken wir über den Tellerrand hinaus, weil wir außerhalb des Tellerrands stehen,“ so ein Diskussionsteilnehmer. Queere indigene Teilnehmer lenkten die Aufmerksamkeit auf queere indigene Völker in Kanada, deren intersektionale Identität die Zugehörigkeit im postkolonialen Kanada weiter erschwere.
COP27 People‘s Declaration
Eine Plenarsitzung, die noch erwähnt werden sollte, war die Erklärung der „COP27 People’s Declaration“. Während dieser abschließenden Plenarsitzung gaben Vertreter von Gewerkschaften, Jugend-NGOs, Frauen, indigenen Völkern und Umweltorganisationen in diesem Rahmen leidenschaftliche Erklärungen darüber ab, was derzeit auf dem Spiel stehe, wenn sowohl Regierungen (besonders im Westen) als auch die Zivilbevölkerung nicht sofort konkret handelten oder handeln könnten.
Climate Action Network (CAN) International, ein globales Netzwerk von mehr als 1.800 zivilgesellschaftlichen Organisationen in über 130 Ländern, betonte, dass wir nur durch Entkolonialisierung unserer Volkswirtschaften und Gesellschaften wahre und dauerhafte Gerechtigkeit erreichen könnten. Reiche Nationen und Unternehmen müssten sich der anstehenden Aufgabe stellen und die für Klimagerechtigkeit erforderlichen Gelder für Verluste und Schäden auch wirklich bereitstellen.
Organisation & Bilanz
Im Großen und Ganzen verlief die Konferenz geordnet ab, wenn auch einige der Freiwilligen, die dort arbeiteten, oft selbst nicht mehr Bescheid wussten als Außenstehende. Anstatt allerdings im Plenum Zeit mit leeren Floskeln und Erklärungen zu vergeuden, würde ich mir in Zukunft wünschen, dass man sich besonders auf ministerieller Ebene bereits zuvor absprechen würde, um so weniger Zeit im Plenarsaal zu verlieren.
Es war eine dennoch großartige Chance, live Teil eines solch monumentalen Klimagipfels mit mehr als 40.000 Teilnehmenden sein zu können. Meine COP-Teilnahme bot mir die Möglichkeit, von einer Reihe globaler Klimaschutzmaßnahmen zu erfahren, meine eigenen Erfahrungen zu teilen und Teil der globalen Bewegung zur Bekämpfung des Klimawandels zu sein – der größten Herausforderung der Menschheit.
COP27 hat bestätigt, dass die Welt nicht vom Pariser Abkommen abrücken möchte; sie ist ein wichtiger Schritt in Richtung Klimagerechtigkeit. Jedoch jeder Mensch weiß, dass viel mehr nötig ist. COP27 hat ein neues Kapitel über die Finanzierung von Verlusten und Schäden eröffnet und die Grundlagen für eine neue Form der Solidarität zwischen Nationen geschaffen. Wie Kommissionspräsidentin Von der Leyen sagte: „Ohne Klimagerechtigkeit kann auch nicht dauerhaft gegen den Klimawandel vorgegangen werden.“
Jetzt müssen Worte in Taten umgesetzt werden, damit wir in Dubai bei COP28 dem 1,5 Grad-Ziel wirklich näher rücken. Hoffen wir, dass diese Tagung dann nicht ganz so chaotisch verläuft wie in Scharm el-Scheich, sondern zu besonders kraftvollen Ergebnissen führt, um das 1,5 Grad-Ziel nicht doch zu verlieren. Ob es dann die Forderung nach einem Ausstieg aus den fossilen Energien – eigentlich eine logische Konsequenz des Klimaschutzes – endlich in das Abschlussdokument schafft?




![16.08. | De Knippschaff kommt nach Rhöndorf 7 [object Object]](https://honnef-heute.de/wp-content/uploads/2024/06/AntoniterKnipp-web-150x150.jpg)