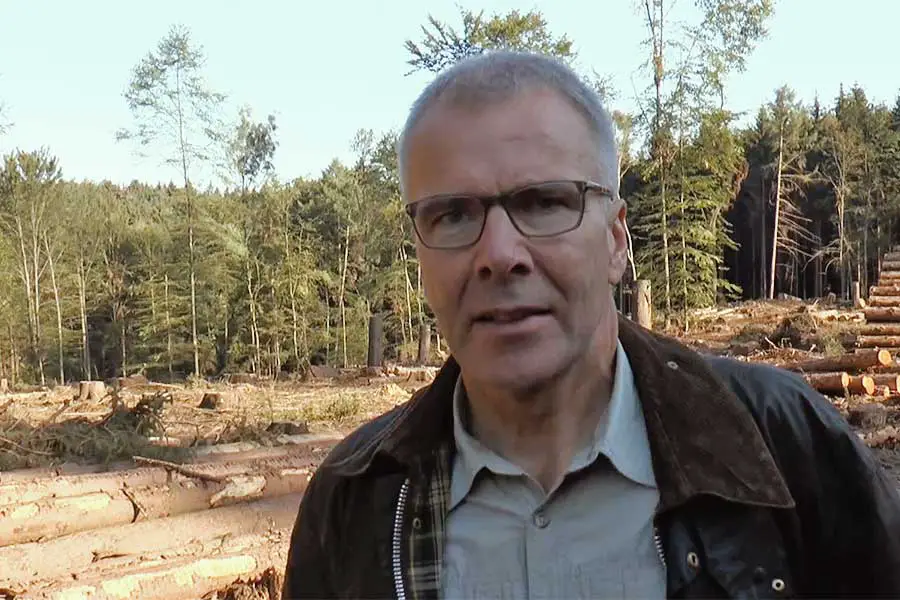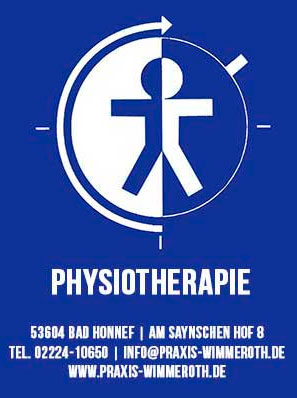Was macht eigentlich der Stadtwald?
Bad Honnef - Alarm im August 2019! Durch den Bad Honnefer Stadtwald…
Fichtensterben in NRW geht weiter – Gegenmaßnahmen dennoch nicht erfolglos
Bad Honnef - Das Sterben der Fichten in den deutschen Wäldern nimmt…
Kommt jetzt die Waldbewirtschaftung nach dem Bad Honnefer Modell?
Bad Honnef - Der Wald ist nicht mehr das, was er einmal…
Wald wird sich verändern, aber er wird bleiben
Bad Honnef - Georg Pieper ist der neue Bad Honnefer Stadtförster. Im…
Jägerinnen und Jäger gehen im Stadtwald auf die Jagd
Bad Honnef - Bis Freitag ist das Schmelztal zu bestimmten Tageszeiten gesperrt.…
BUND-Sprecher empfiehlt Beirat: Fichteneinschlag stoppen
Auch Neubauplanungen sollten überprüft werden, denn Neubau sei außerordentlich klimaschädigend
Stadtwald: Grüne Jugend holte Naturschutzschild aus Schieflage
Bad Honnef - Monatelang lag das Hinweisschild des Rhein-Sieg-Kreises auf dem Parkplatz…
Stadtwald: Klima, Borkenkäfer und kein Ende
Bad Honnef - Trockenheit und Borkenkäfer - ein Ende ist nicht in…
Statistisches Bundesamt: 32 Millionen Kubikmeter Schadholz
Bad Honnef - Die heimischen Wälder litten in den vergangenen Jahren unter Trockenheit…
Herausforderung Wald – Welche Konzepte sind erfolgversprechend? – Neue Diskussion „Nationalpark“?
Bad Honnef - Waldökologe Pierre Ibisch von der Hochschule für nachhaltige Entwicklung…
Auf Hitze folgen Gewitter – Regen wird dringend benötigt
Region - Die "Hitzewelle" hat Deutschland erreicht. Es ist hochsommerlich warm und vielerorts…
Die Borkenkäferkatastrophe setzt sich fort
Forstamtsleiter Stephan Schütte zur Situation im Bad Honnefer Stadtwald
Revierförster-Appell nach Sturm Friederike: „Bitte sind Sie vorsichtig!“
Bad Honnef | Auch nach dem Sturm ist die Gefahr nicht vorbei.…